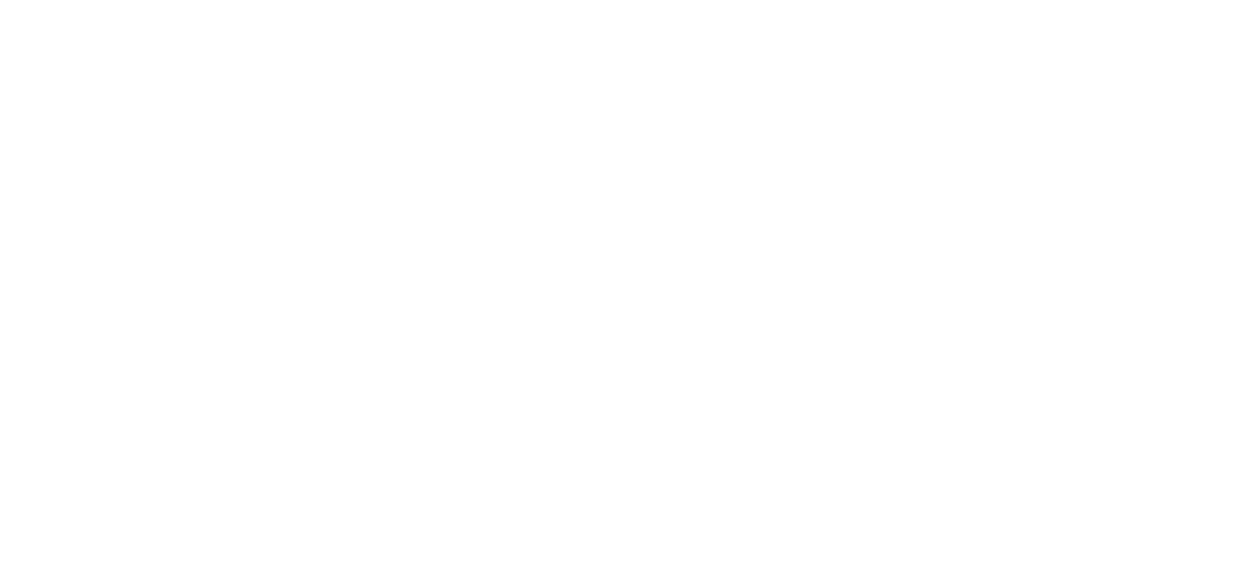digitales
PROGRAMMHEFT
Saison der Wirbelstürme
Nach dem gleichnamigen Roman von Fernanda Melchor
Aus dem mexikanischen Spanisch von Angelica Ammar
Aus dem mexikanischen Spanisch von Angelica Ammar
Online-Uraufführung:
18 Juni 2021
»Everything that happens in
hurricane season is about
the lack of love.
You will never say it's
a love novel, but it is in fact.«
Fernanda Melchor
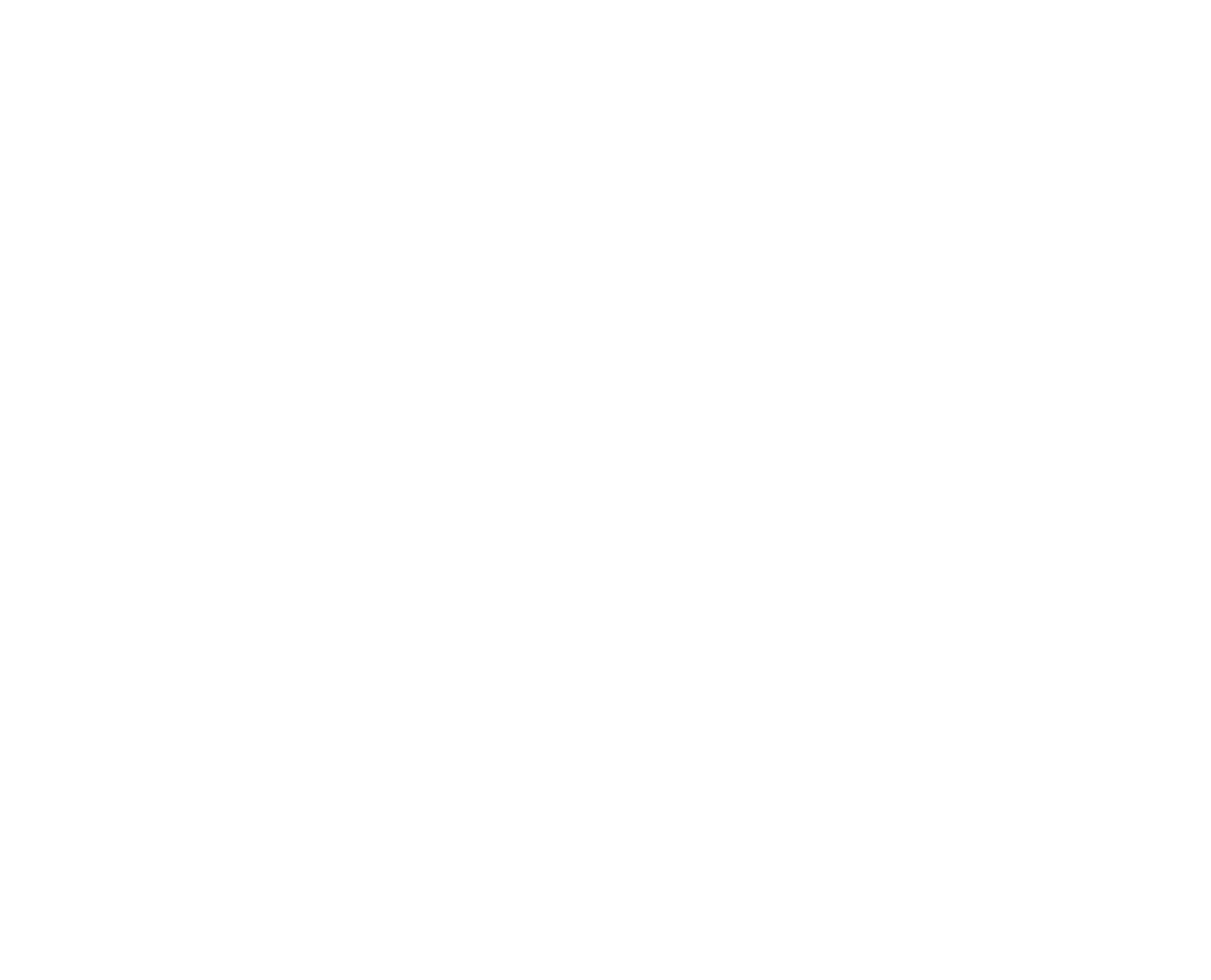
INHALTSVERZEICHNIS
Besetzung
ZUM STÜCK
Tatmotiv: Hexerei. Der Entstehungsprozess von SAISON DER WIRBELSTÜRME beginnt vor einigen Jahren, als Fernanda Melchor in der Zeitung vom Mord an einer Dorfhexe in der Nähe der mexikanischen Hafenstadt Veracruz liest. Verwundert über die Selbstverständlichkeit, mit der in der Presse von Aberglaube und Zauberei berichtet wird, begibt sich die Autorin auf die Suche nach den Hintergründen des Mordes. Während ihrer Recherche stößt sie auf ein explosives Geflecht aus organisiertem Verbrechen, politischen Interessen und Drogenkriminalität und erkennt, dass eine journalistische Aufarbeitung des Tathergangs zu gefährlich ist. Melchor entschließt sich daher, die Begebenheiten stark zu fiktionalisieren, in Romanform zu gießen und mit ihrer eigenen Fantasie zu unterfüttern. »Einige der hier erzählten Begebenheiten sind real. Alle Personen sind fiktiv«, heißt es auf der ersten Seite.
Ausgangspunkt dieser Sozialstudie über die mexikanische Provinz ist der Leichenfund einer sagenumwobenen Frau.Sie wird in flirrenden Hitze zwischen Schilf und den Motorengeräuschen der Landstraße in einem Zuckerrohrfeld tot aufgefunden. Über Jahre hinweg war sie das Gesprächsthema Nummer eins der Dorfbewohner*innen von La Matosa. Verehrt, verachtet, gefürchtet und von allen nur »die Hexe« genannt, erzählt man sich die schauerlichsten Geschichten über sie: sie treibe es mit dem Teufel, spreche mit den Toten, braue allerlei Heilmittel zusammen. Ihre Mutter galt damals schon als Hexe, sie selbst als ein Produkt der Hölle, von dem man nicht einmal genau weiß, ob Frau oder Mann. Doch nun ist sie tot, zurückgelassen hat sie lediglich ein heruntergekommenes Haus, einen Horrorschuppen, in dem sie zu Lebzeiten wilde Orgien veranstaltete und jungen Prostituierten zu Abtreibungen verhalf.
Stück für Stück erschließt sich die Vorgeschichte des Mordes durch den multiperspektivischen Plot sechs verwaister Seelen: Yesenia, die schon früh lernte, Verantwortung für ihre Familie zu übernehmen, vor allem für ihren aufmüpfigen Cousin, Luismi. Statt Dankbarkeit erfährt sie von ihrer Großmutter Prügel und Herabwürdigung. Luismi, Munra und Brando können der Perspektivlosigkeit und Armut nur durch den täglichen Vollrausch entkommen. Luismi glaubt, er werde bald Vater – ein trügerischer Hoffnungsschimmer. Munras besten Jahre sind nach einem schweren Motorradunfall vorbei, der Ewig-Junggebliebene erstickt in Sorgen um seine verschwundene Frau Chabela. Diese wiederum prostituiert sich, seit sie denken kann, ihr Sohn Luismi war ein Fehler, verbaute ihr die Karriere zur Puffmutter. Brandos sexuelle Fantasien treiben ihn zur Weißglut, genauso wie seine strenggläubige Mutter, die mittlerweile überzeugt ist, in ihm stecke der Teufel. Und dann ist da noch die 13-jährige Norma, die vor den Konsequenzen ihrer ungewollten Schwangerschaft flieht, in die Arme der Hexe. Und der von Chabela.
Ausgangspunkt dieser Sozialstudie über die mexikanische Provinz ist der Leichenfund einer sagenumwobenen Frau.Sie wird in flirrenden Hitze zwischen Schilf und den Motorengeräuschen der Landstraße in einem Zuckerrohrfeld tot aufgefunden. Über Jahre hinweg war sie das Gesprächsthema Nummer eins der Dorfbewohner*innen von La Matosa. Verehrt, verachtet, gefürchtet und von allen nur »die Hexe« genannt, erzählt man sich die schauerlichsten Geschichten über sie: sie treibe es mit dem Teufel, spreche mit den Toten, braue allerlei Heilmittel zusammen. Ihre Mutter galt damals schon als Hexe, sie selbst als ein Produkt der Hölle, von dem man nicht einmal genau weiß, ob Frau oder Mann. Doch nun ist sie tot, zurückgelassen hat sie lediglich ein heruntergekommenes Haus, einen Horrorschuppen, in dem sie zu Lebzeiten wilde Orgien veranstaltete und jungen Prostituierten zu Abtreibungen verhalf.
Stück für Stück erschließt sich die Vorgeschichte des Mordes durch den multiperspektivischen Plot sechs verwaister Seelen: Yesenia, die schon früh lernte, Verantwortung für ihre Familie zu übernehmen, vor allem für ihren aufmüpfigen Cousin, Luismi. Statt Dankbarkeit erfährt sie von ihrer Großmutter Prügel und Herabwürdigung. Luismi, Munra und Brando können der Perspektivlosigkeit und Armut nur durch den täglichen Vollrausch entkommen. Luismi glaubt, er werde bald Vater – ein trügerischer Hoffnungsschimmer. Munras besten Jahre sind nach einem schweren Motorradunfall vorbei, der Ewig-Junggebliebene erstickt in Sorgen um seine verschwundene Frau Chabela. Diese wiederum prostituiert sich, seit sie denken kann, ihr Sohn Luismi war ein Fehler, verbaute ihr die Karriere zur Puffmutter. Brandos sexuelle Fantasien treiben ihn zur Weißglut, genauso wie seine strenggläubige Mutter, die mittlerweile überzeugt ist, in ihm stecke der Teufel. Und dann ist da noch die 13-jährige Norma, die vor den Konsequenzen ihrer ungewollten Schwangerschaft flieht, in die Arme der Hexe. Und der von Chabela.
Mina Salehpour und ihr Team nehmen sich diesem abgründigen Schauermärchen pandemiebedingt in einer digitalen Mini-Serie an und schälen die Zerbrechlichkeit der Figuren im Milieu von Korruption, Folter, Femiziden und Bordellen fein heraus.
»I wanted to write in cold
blood. I wanted to show how
in Mexico a woman can be
killed for nothing and still
nothing happens«
Fernanda Melchor
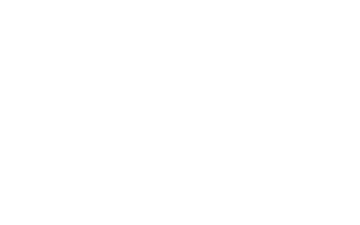
ZUR AUTORIN
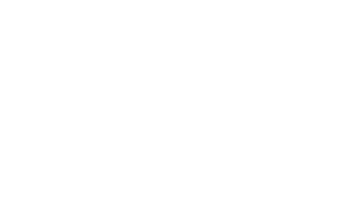
Fernanda Melchor wird 1982 in Veracruz geboren, einem Bundesstaat an der Küste des Golfs von Mexiko. Die Schauplätze in SAISON DER WIRBELSTÜRME sind an diese Gegend angelehnt. Die Autorin wächst in einem Milieu auf, in dem Drogenkriege der Narcos, Prostitution junger Frauen und Femizide, (also der Mord an Frauen, weil sie Frauen sind) zum Alltag gehören. Nicht selten werden Massengräber gefunden, in denen Hunderte Leichen aus Gewaltverbrechen verscharrt wurden. Die Investigativjournalist*innen, die diese Missstände aufdecken, leben prekär und in ständiger Angst, aufgrund ihrer Recherchen ermordet zu werden. Auch Melchor wollte zunächst Journalistin werden, bevor sie sich aus Selbstschutz dazu entschloss, ihre Beobachtungen zu fiktionalisieren. Nach ihrem Studium der Journalisitk veröffentlichte sie Reportagen und Erzählungen. Schnell avanciert sie zu einer der wichtigsten Stimmen Lateinamerikas. SAISON DER WIRBELSTÜRME ist ihr zweiter Roman, der seither in 15 Sprachen übersetzt worden ist. 2019 erhielt sie dafür den Anna-Seghers-Preis sowie den Internationalen Literaturpreis vom Berliner Haus der Kulturen der Welt.
»Als ich anfing zu schreiben, hörte ich mit der Zeit die Stimmen der verschiedenen Figuren, die mir ihre Geschichte erzählten. Also versuchte ich, eine Erzählerstimme zu finden, die gleichzeitig in den Figuren und außerhalb von ihnen sein sollte«, sagt Melchor in einem Interview.
Ihr Schreiben haben vor allem die Werke von Gabriel García Márquez und Stephen King geprägt. Melchors Texte wirken häufig wie ein soghafter Wirbelsturm: Sie gehen unter die Haut, schütteln die Leser*innen durch und spucken sie atemlos wieder aus. Die Sprache, mit der sie das Elend der gebeutelten Bewohner*innen von La Matosa porträtiert, ist dabei oft schonungslos brutal. Obwohl Melchor ein pessimistisches Bild heranwachsender Generationen in Mexiko zeichnet und dabei die Wut über die Perspektivlosigkeit immer wieder in den Vordergrund stellt, handelt der Roman vor allem von Liebe. Oder der Suche nach dieser. Sie habe zeigen wollen, was an einem kleinen Ort geschehen kann, der vom Staat und der Gesellschaft vergessen wird. Was mit Menschen passiert, um die sich niemand kümmert.
»Als ich anfing zu schreiben, hörte ich mit der Zeit die Stimmen der verschiedenen Figuren, die mir ihre Geschichte erzählten. Also versuchte ich, eine Erzählerstimme zu finden, die gleichzeitig in den Figuren und außerhalb von ihnen sein sollte«, sagt Melchor in einem Interview.
Ihr Schreiben haben vor allem die Werke von Gabriel García Márquez und Stephen King geprägt. Melchors Texte wirken häufig wie ein soghafter Wirbelsturm: Sie gehen unter die Haut, schütteln die Leser*innen durch und spucken sie atemlos wieder aus. Die Sprache, mit der sie das Elend der gebeutelten Bewohner*innen von La Matosa porträtiert, ist dabei oft schonungslos brutal. Obwohl Melchor ein pessimistisches Bild heranwachsender Generationen in Mexiko zeichnet und dabei die Wut über die Perspektivlosigkeit immer wieder in den Vordergrund stellt, handelt der Roman vor allem von Liebe. Oder der Suche nach dieser. Sie habe zeigen wollen, was an einem kleinen Ort geschehen kann, der vom Staat und der Gesellschaft vergessen wird. Was mit Menschen passiert, um die sich niemand kümmert.
»Die Hexe verkörpert die
von jeglicher Dominanz,
von jeglichen Begrenzungen
befreite Frau; sie ist ein
anzustrebendes Ideal,
sie weist den Weg.«
Mona Chollet
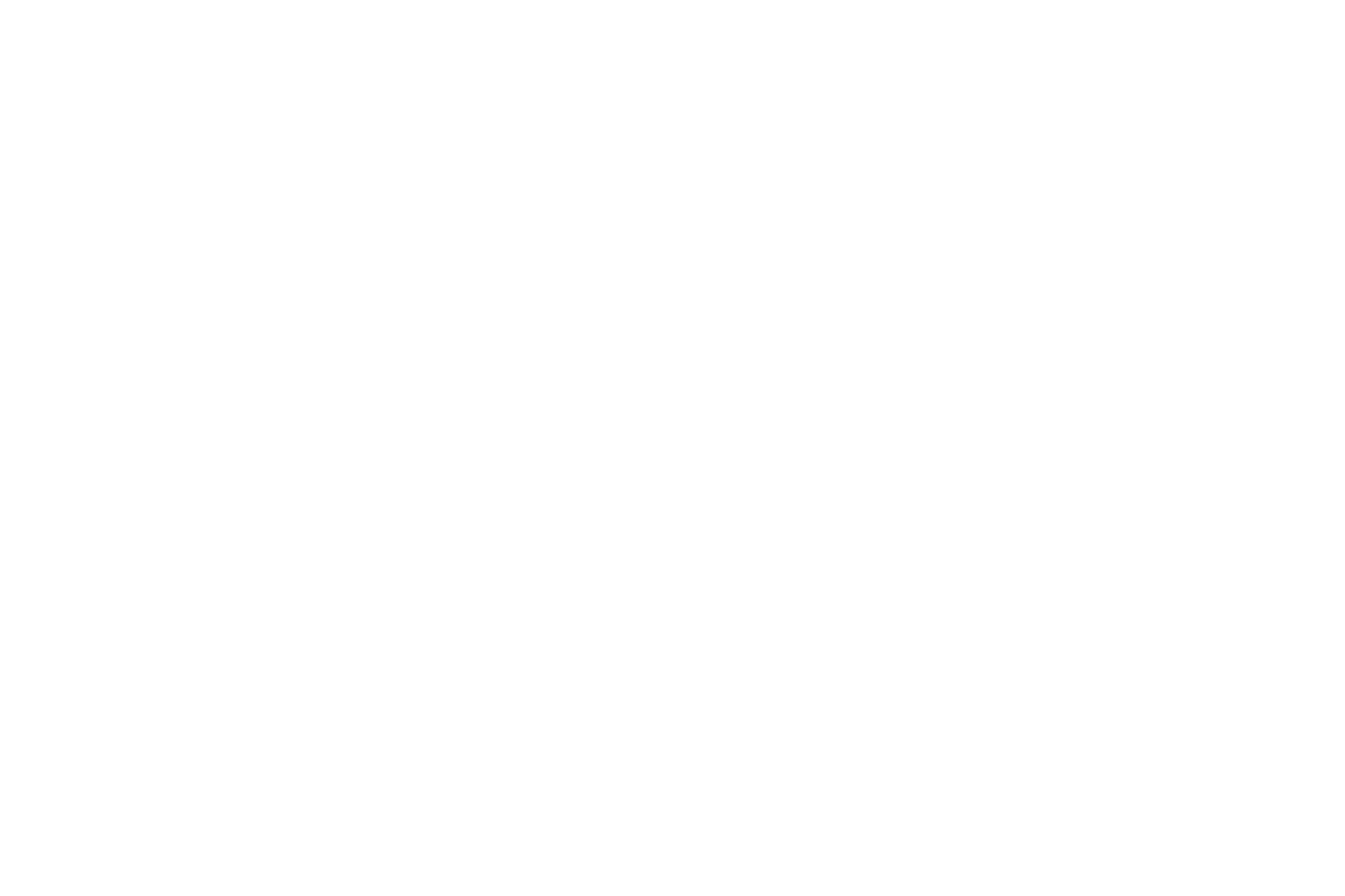
DER WIND DER WUT
EIN INTERVIEW MIT MARLENE PARDELLER (#KEINEMEHR)
Alle zwei bis drei Tage stirbt in Deutschland eine Frau* unter gewaltsamen Umständen. In Argentinien alle 30 Stunden, in Brasilien sorgte kürzlich der Mord an einer 19-jährigen E-Sportlerin für Aufsehen. Der Täter war selbst Gamer und handelte offenbar aus Hass an Frauen*. Auch in Fernanda Melchors Roman SAISON DER WIRBELSTÜRME, der am Schauspiel Köln zur Uraufführung kommt, ist die Gewalt an jungen Frauen* in Mexiko ein zentrales Thema. Dort erreichte 2020 die Zahl der jährlichen Frauenmorde einen neuen Höchststand. Doch wie sieht die Situation in Deutschland aus? Die Initiative #KeineMehr untersucht Femizide – also den Mord an Frauen*, weil sie Frauen* sind – in Deutschland. Ein Gespräch über fehlende Statistiken, unterfinanzierte Frauenhäuser und den Widerstand demonstrierender Frauen*.
Die Initiative #KeineMehr fordert ein breiteres Bewusstsein und Sichtbarkeit von Femiziden. Was war der Impuls zur Gründung und welche Ziele verfolgen Sie darüber hinaus?
Ich habe mich 2016 für eine Filmrecherche in Mexiko vorbereitet und im Zuge dessen meine Kollegin Alex Wischnewski für ein Vorgespräch getroffen, die das Land gut kennt. Vor Ort war ich beeindruckt von den Demonstrationen, von den Zielen der feministischen Organisationen, von der offenen Thematisierung der Morde und dem Ausmaß der Gewalt. In Deutschland gibt es eine starke Faszination für das, was in Lateinamerika gerade passiert, da die feministischen Kämpfe dort sehr präsent sind und eine große Öffentlichkeit erfahren. Die Frauen* haben keinen Bock mehr. Und ihre Wut kommt mittlerweile bis hierher. Alex Wischnewski und ich haben uns dann die Frage gestellt: »Wie sieht das eigentlich in Deutschland aus?«, haben allerdings kaum Zahlen dazu gefunden. Außer die polizeiliche Kriminalstatistik, die nach jahrelangem Druck der Frauenhäuser seit den 70er-Jahren etabliert wurde. Die Frauenhäuser wissen aus ihrer Arbeitserfahrung, dass viel passiert, was sie nicht mit Zahlen belegen können. Die polizeiliche Kriminalstatistik umfasst derzeit Tötungen in Partnerschaften oder ehemaligen Partnerschaften. Jeden zweiten bis dritten Tag wird hier eine Frau* ermordet. Wir brauchen mehr Untersuchungen, Statistiken, Hintergründe. Das ist unsere Motivation.
Vor allem, weil die bisherigen Daten sich nur auf die Morde beziehen, die vom Partner oder vom Ex-Partner verübt werden und nicht auf Femizide außerhalb von Partnerschaften.
Müssten die nicht berücksichtigt werden?
Ja, denn das bedeutet nicht, dass in Deutschland keine Tötungen von Frauen* außerhalb von Partnerschaften stattfinden. Die Zahl aller Ermordeten liegt zwar vor, ist allerdings nach Geschlecht aufgeteilt. Binär, nach männlich und weiblich. Was es nicht gibt, ist eine Zusammenfassung der Ermordeten unter dem spezifischen Begriff des Femizids und dabei handelt es sich nicht einfach um eine ermordete Frau*. Wenn eine Frau* auf der Straße läuft, ihr die Handtasche gestohlen und sie im Zuge dessen ermordet wird, muss das erst mal kein Femizid sein. Es könnte einer sein. Aber eigentlich geht es darum, dass ihr das Geld weggenommen wird und das hätte genauso gut einem Mann passieren können. Ein Femizid zeichnet sich dadurch aus, dass eine Person vernichtet wird, weil sie als Frau* gelesen wird oder weil sie als Person gelesen wird, die sich nicht dem normierten Geschlechtercode entsprechend verhält. Eine Person, die im Auge des Betrachters eine Grenze überschreitet. Dazu bräuchte es dringend Zahlen, um zu verstehen, was die Motive hinter Femiziden sind, wie stark die Misogynie in der Gesellschaft verwurzelt ist und wie man dem vorbeugen kann.
#KeineMehr verwendet auch den Begriff »Feminizid«. Worin liegt der Unterschied zum »Femizid«?
Diana E. H. Russell und Jill Radford haben in den 70er-Jahren den englischen Begriff »femicide« geprägt. 1976 gab es in Brüssel ein internationales Tribunal, um über Frauengewalt zu sprechen, an dem Frauengruppen aus der ganzen Welt teilgenommen haben. Da ist dieser Begriff erstmals verwendet worden. Dann ist er allerdings wieder in Vergessenheit geraten. Wir haben über Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt, aber nicht mehr über Frauenmorde gesprochen. Wiederaufgenommen wurde der Begriff im lateinamerikanischen Kontext der Neunzigerjahre, als in Ciudad Juárez eine gewaltvolle Mordreihe an Fabrikarbeiterinnen stattgefunden hat, die zum Teil gar nicht mehr oder zerstückelt an öffentlichen Plätzen aufgefunden wurden. Die mexikanische Soziologin Marcela Lagarde hat den Begriff »femicide« daraufhin wiederaufgenommen, aber angeglichen und daraus »feminicidio« gemacht, weil »femicide« zu nahe am Begriff »homocide« liegt. Sie wollte auf ein strukturelles Problem aufmerksam machen, weg von der Einzeltäterschaft. Feminizid ordnet den Tod der Frau* also gesellschaftspolitisch ein, sprich Tötungsdelikte an Frauen* als Folge von Geschlechterdiskriminierung.
Worin liegen die Gründe für den Hass und die Gewalt an Frauen*, die dann in Femiziden münden?
Ich glaube, diesen einen Grund gibt es nicht. Es ist nicht monokausal, sondern es gibt vielerlei Gründe und Momente. Einer, den wir in der Arbeit von #KeineMehr herausgefunden haben, ist das starke Festhalten an der Zweigeschlechtlichkeit. Einer Gesellschaft der Vielfalt zum Trotz. Und dieses Festhalten daran passiert auf mehreren Ebenen: in den Medien, in der Schule, in der Erziehung, in politischen Kontexten. Das Bewusstsein dafür, dass das Einfordern von zwei Geschlechtern mit Gewalt verbunden ist, ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Gesellschaftlich ist eine Bewegung sichtbar. Es gibt viel mehr Stimmen, die laut werden und sagen: »Wir wollen nicht mehr.«
Erfahren Transfrauen und Migrantinnen eine andere Form von Frauenhass?
Die Misogynie in unserer Gesellschaft ist enorm und wir spüren diese oft komplett unterschiedlich. Je nachdem, ob wir mit dem Geschlecht, was uns bei der Geburt zugewiesen wurde, im Einklang stehen oder ob das nicht passt. Zudem werden die Abhängigkeiten sichtbar. Zum Beispiel von Frauen*, die nach Deutschland migriert sind und sich in einem deutschen Staat wiederfinden, in dem das Verständnis vorherrscht: Wenn ihr in Deutschland bleiben wollt, dann ist euer Aufenthaltsrecht in den ersten fünf Jahren an euren Ehemann gekoppelt. Wenn solche Frauen* in Gewaltbeziehungen stecken, dann schaffen sie es oft nicht, sich zu lösen. Der deutsche Staat unterstützt ein patriarchales Besitzdenken. Sie haben eben von dem Wind der Wut gesprochen, der nach Deutschland weht. Wie kommt es, dass wir Bilder protestierender, wütender, starker Frauen*, die zu Tausenden auf die Straße gehen, vornehmlich aus Lateinamerika kennen und nicht aus Deutschland? 2015 wurde die 14-jährige Chiara Páez von ihrem 16-jährigen Freund ermordet. Sie war schwanger und wollte nicht abtreiben, der Täter vergrub die Leiche mithilfe seiner Familie im Garten. Dieser Fall war für Argentinien ein einschneidender Punkt nach jahrelangen Femiziden, der eine enorme Wut hervorgerufen hat, die bis heute anhält und auch in Italien, Spanien, Frankreich und Polen zu spüren ist. In Deutschland ist das anders. Das liegt unter anderem an der ganz spezifischen Rolle Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Land, dessen Großteil der Bevölkerung die NS-Politik aktiv gewollt und befördert hat, musste 1945 eine reale historische Niederlage erleben. Und das bedeutete für die meisten, die die NS-Politik mitgetragen haben, dass sie nicht trauen durften oder konnten. Die Zeit, darüber zu sprechen, gab es nicht, weil es wichtig war, alles von sich wegzuschieben, um weiterzumachen. Mit diesem Schweigen und dem fehlenden Zugang zu Emotionen der Nachkriegsgenerationen haben wir es heute noch zu tun.
Welche Erfahrungen haben Sie während Ihres Drehs zum Dokumentarfilm
»UNTER DER HAUT LIEGEN DIE KNOCHEN« in Mexiko gemacht?
Eigentlich wollte ich 2012 einen Film über feministische Gruppen in Italien machen. Mir war zunächst nicht bekannt, dass die Zahlen der ermordeten Frauen* in Italien ähnlich hoch sind wie in Mexiko. Das hat mich nachhaltig beschäftigt und irritiert – dass man diese zwei Realitäten miteinander vergleichen konnte. Deshalb bin ich nach Mexiko gefahren und habe mit Aktivistinnen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten gesprochen. Ich habe dort ein ganz persönliches Interesse der Frauen* gespürt, weil sie entweder einen Mordfall zu beklagen hatten oder eine Person, die verschwunden war. Femizide waren kein abstraktes theoretisches Konstrukt, sondern eine Not, die aus dem Alltag heraus entstanden ist. Das waren die beeindruckendsten Demos, die ich gesehen habe und die klügsten Leute, die ich getroffen habe, weil sie mit enormer Klarheit die patriarchale Gewalt benennen konnten: Polizei, Ehemann, Arbeitgeber, der Typ da auf der Straße und die internationale Wirtschaftskooperation zwischen den USA und Mexiko. Als ich dann zurück nach Italien gekommen bin, war das Schweigen so massiv spürbar, gerade im Kontrast.
Sind Sie dort auch mit den sogenannten »nota roja« (dt.: rote Artikel), kleinen Zeitschriften, die Fotos von Leichen und Tatorten offensiv abdrucken, in Berührung gekommen?
Ich habe das beobachtet und daraufhin mit dem Kameramann Sergio Silva Azúa aus Mexiko City über den größeren Zusammenhang dahinter gesprochen. Dieser hat es mir so erklärt: Dadurch, dass Mexiko so lange unter kolonialer Gewaltherrschaft stand, hat dort über Jahrhunderte eine massive Gewöhnung an Gewalt stattgefunden, die bis heute nie wirklich aufgearbeitet worden ist. In einem Ausmaß, wie ich sie mir nicht vorstellen kann. Zum anderen hat sich die Drogenroute in den 1990er-Jahren verändert und wurde über Mexiko umgeleitet. Plötzlich waren die Auswirkungen der Drogenkriege zu spüren. In den frühen 2000ern waren Leichen Teil des Alltags. Wenn du zur Schule gefahren bist, hingen Menschen an den Brücken. Durch dieses Exponieren der Leichen im öffentlichen Raum, meinte Sergio Silva Azúa, hat eine Abstumpfung stattgefunden, die es leichter macht, diese extremen Bilder abzudrucken.
Bleiben wir mal bei der Berichterstattung. Wenn man über Frauenmorde liest, fallen oft Begriffe wie »Eifersuchtsdrama« oder »Familientragödie«. Ist die Berichterstattung
über Femizide in Deutschland ausreichend?
Diese Begriffe sind motiviert und nicht neutral. Die Begriffe wie »Eifersuchtsdrama«, »Beziehungstat« und »Familientragödie« reißen eine Tat aus einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang und privatisieren sie. Gerade bei »Familie« oder »Eifersucht« befinden wir uns in einem privaten Raum, in dem nur zwei Leute beteiligt sind und der Rest der Gesellschaft nichts damit zu tun hat. Mit den Begriffen wie »Tragödie« oder »Drama« sind wir eigentlich im Theater. Das produziert eine Distanzierung, aber auch Effekthascherei. Es wird uns das Schicksalhafte, das Unabänderliche daran vorgeführt. Häufig stellen die Artikel auch inhaltlich keinen gesellschaftlichen Zusammenhang mit dem strukturellen Problem her. Neben der Verharmlosung und Privatisierung des Femizids gibt es noch ein größeres Problem: die Rassifizierung des Tatbestandes. Wenn der Begriff des »Ehrenmords« eingesetzt wird zum Beispiel. Zum ersten Mal fällt hier überhaupt mal das Wort »Mord«. Und dieser wird zurückgeführt auf eine vermeintliche Herkunft des Täters. Was oft nicht stimmt, weil die Täter sehr häufig Deutsche sind. Das ist ein patriarchales Problem, das man nicht rückkoppeln kann an eine bestimmte Kultur.
Und auch nicht auf ein soziales Milieu.
Absolut. Es handelt sich um eine Gewalt, die klassenübergreifend ist und die keine nationalen und kulturellen Grenzen kennt.
Blicken wir mal auf das Corona-Jahr, in dem die häusliche Gewalt gestiegen ist und die Bedeutung der Frauenhäuser auch. Wie schätzen Sie die Situation ein?
Meiner Erfahrung nach hat Corona im Hinblick auf häusliche Gewalt wie auch auf viele andere gesellschaftliche Bereiche Probleme erst mal verstärkt. Die Schieflagen sind deutlicher zum Vorschein gekommen. Es kann sein, dass die häusliche Gewalt gestiegen ist, aber die Zahlen sind seit vielen Jahren schon hoch. Die Frauenhäuser berichten uns, dass es schwieriger für Frauen* geworden ist, sich Hilfe zu holen, weil sie in ihren privaten Räumen mit den Tätern eingeschlossen sind. Frauenhausplätze sind seit Jahren ausgebucht und absolut unterfinanziert. In Berlin wurden zuletzt leerstehende Hotels genutzt, um Frauen* unterzubringen. Es gibt außerdem zu wenig Mitarbeiterinnen. Für diese war das Jahr eine unglaubliche Herausforderung. Und dann wird das Digitale Deutsche Frauenarchiv auch noch aus dem gleichen Geldtopf finanziert wie die Frauenhäuser. Da werden zwei Dinge gegeneinander ausgespielt, die so wichtig sind. Das ist eine Verknappung der Mittel, die nicht notwendig sein müsste.
Oft geht der Unterbringung in einem Frauenhaus ein langer innerer Kampf der Frauen voraus. Die Rechtsanwältin Christina Clemm sagt, nach einer Anklage dauert es zwischen zwei und vier Jahren, bis es zur Urteilssprechung kommt. Das macht diese Entscheidung nicht leichter, oder?
Sich aus Gewaltsituationen zu lösen, ist sowieso schon sehr schwierig. Und wenn du es dann schaffst, hast du es mit einem misogynen Polizeiapparat zu tun, weil die Ausbildung fehlt und mit einem Justizapparat, bei dem es ähnlich aussieht und mit Frauenhäusern, die all das auffangen müssen. Das ist keine dauerhafte Lösung, das ist eine Zwischenlösung, eine Unterstützung. Aber es muss eine andere gesellschaftliche Einbindung geben, damit die Selbstständigkeit der Frauen* unterstützt, leistbare Wohnungen zur Verfügung gestellt, Arbeitsplätze ermöglicht und Gerichtsprozesse beschleunigt werden. Das ist nicht die Aufgabe der Frauen*. Das muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen werden und einige Entscheidungsträger*innen sträuben sich noch, diese Verantwortung zu übernehmen.
Das Interview führte die Dramaturgin Lea Goebel.
»Wenn du wüsstest,
wie satt ich die Welt habe,
wie gern ich fortginge,
nur wohin, weiß ich nicht,
weit fort von all dem Krampf.«
Gabriel García Márquez - Der Herbst des Patriarchen
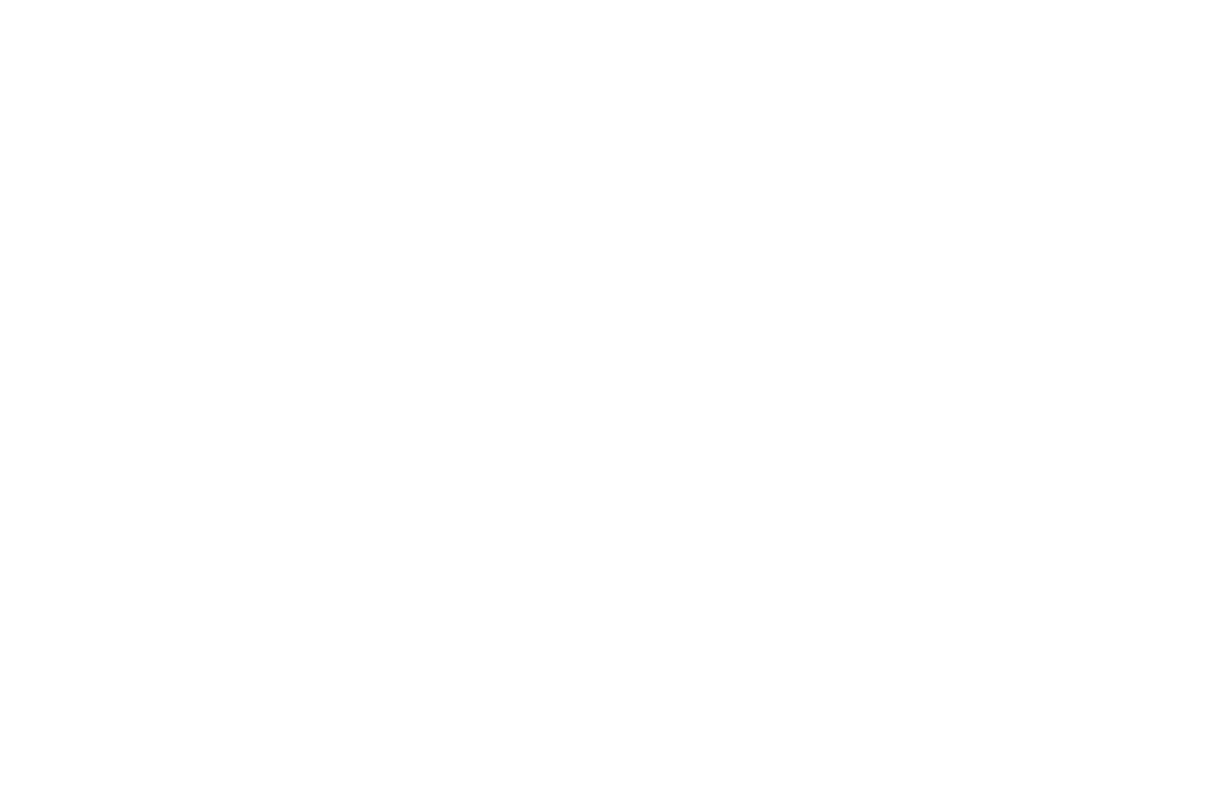
»Saison der Wirbelstürme«
Internationaler Literaturpreis 2019 (HKW)
Im Sommer 2019 war die Autorin Fernanda Melchor zu Gast im »Haus der Kulturen der Welt« in Berlin. Im Gespräch mit dem Moderator Daniel Medin und der Übersetzerin Angelica Ammar, spricht sie unter anderem über den Entstehungsprozess des Romans und ihre literarischen Vorbilder.
We are the witches
you were not able to burn
Seit den 60er-Jahren gibt es immer wieder feministische Gruppen, die den Begriff »Hexe« von Klischees befreien und positiv umdeuten möchten. Die Faszination für das Bild der selbstbestimmten Frau beschreibt Mona Chollet in ihrem Buch HEXEN. DIE UNBESIEGBARE MACHT DER FRAUEN.
Hexenverfolgung -
angeklagt wegen praktizierter Zauberei
Zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert fielen der Hexenverfolgung ca. 50.000 bis 100.000 Menschen zum Opfer; überwiegend Frauen. Ein Podcast über ein gewaltvolles Kapitel deutscher Geschichte, die Rolle der Kirche und den damaligen Bestseller »Hexenhammer« des Inquisitors Heinrich Kramer.
Stab
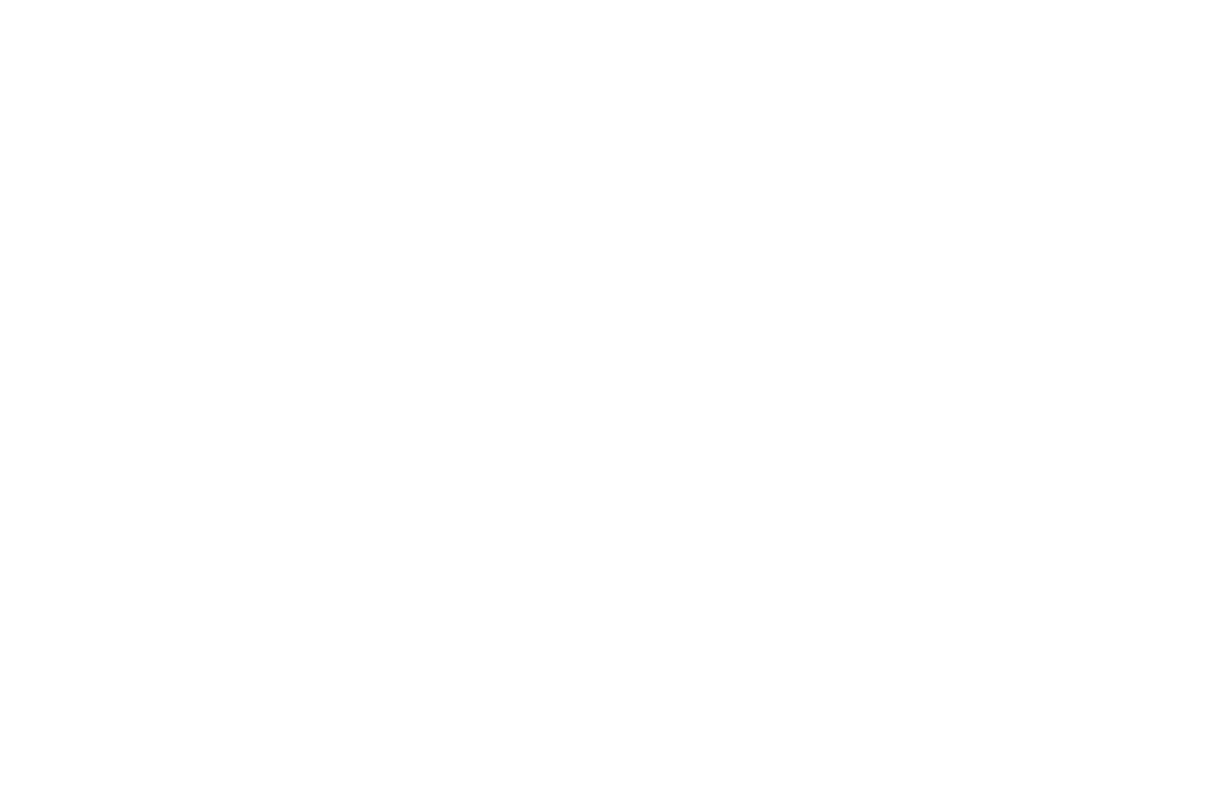
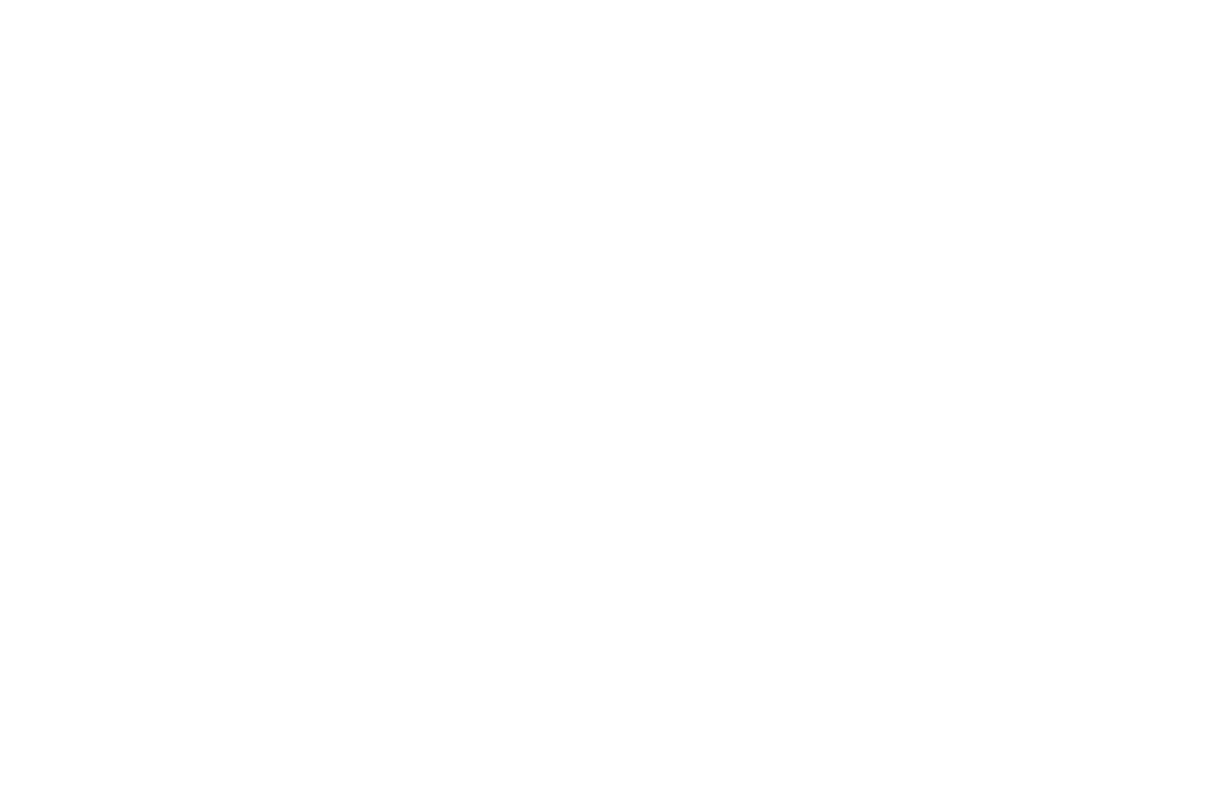
Regie: Mina Salehpour
Bühne: Andrea Wagner
Kostüme: Maria Anderski
Kamera/Schnitt: Nazgol Emami
Licht: Jan Steinfatt
Video: Torsten Döring · Christoph Odendahl
Ton: Holger Brochhaus · Raphael Weiden · CHRISTOPH PRIEBE
Tonmischung: Joschka Tschirley
Dramaturgie: Lea Goebel